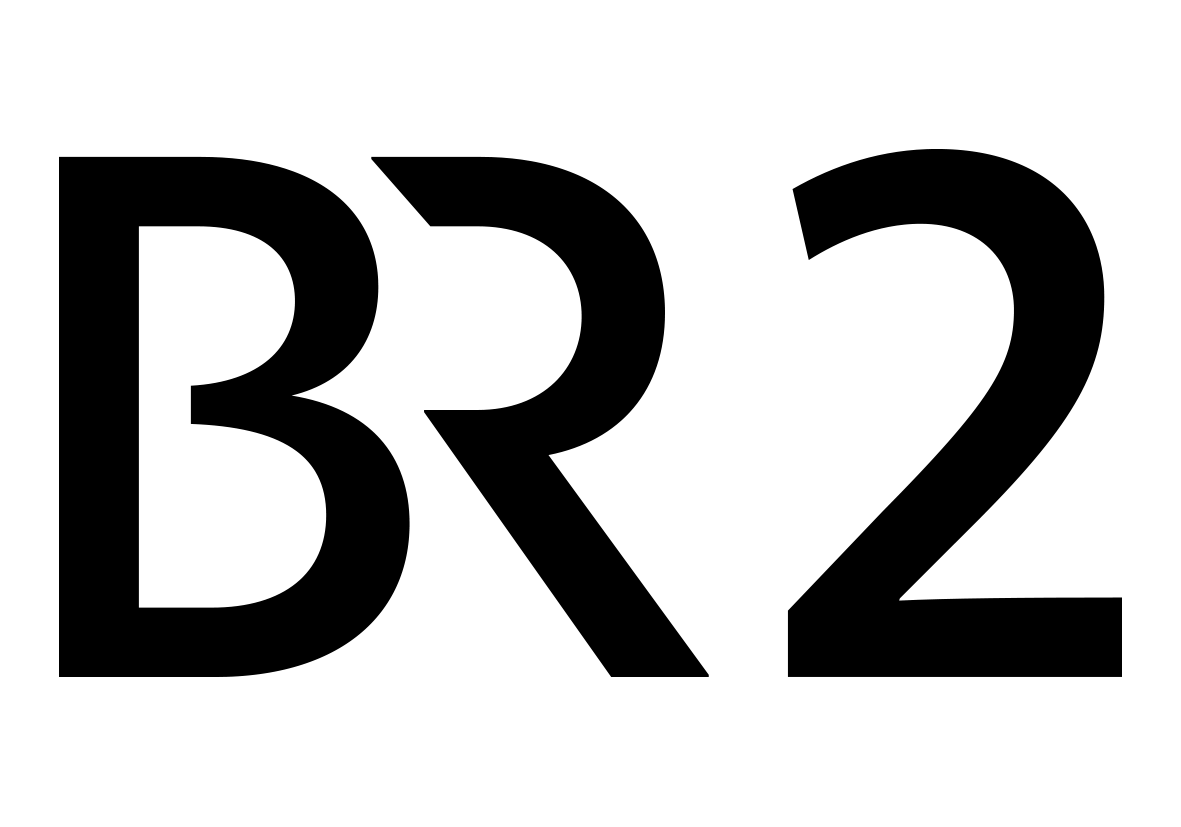Huch, schon vorbei - schade!
Datum
Eine irre ausufernde Familiensaga – gespielt von nur zwei Personen: Wer glaubt, das geht nicht, wird in Friederike Drews' Uraufführung von Steven Uhlys Roman "Mein Leben in Aspik" nicht nur eines Besseren belehrt. Sondern er erlebt tatsächlich eine völlig neue Dimension von Spielwitz, Verwandlungskunst und Überraschungsdramaturgie. Und voller Crazyness, Ironie und tieferer Bedeutung ist die Geschichte auch noch!
Text: C. Bernd Sucher
Ist es eine böse Familiengeschichte? Oder eine witzige? Was daran ist wahr? Was ist Fiktion? Müssen Leserinnen und Leser womöglich aufpassen, dass sie dem Autor und seinen Personen nicht auf den Leim gehen? Wie pervers ist diese Familie eigentlich, von der Steven Uhly in seinem Debütroman "Mein Leben in Aspik" erzählt? Ist sie es überhaupt? Uhly schaut auf die Geschlechter, auf ihre Rollen; er fragt, weil er die Leserinnen und Leser grandios überrumpelt, wie tolerant unsere Gesellschaft eigentlich ist – oder ist sie es womöglich gar nicht? Und – auch das noch! – er lässt uns nicht abhauen aus der deutschen Geschichte: Was war eigentlich im sogenannten Dritten Reich los? Unsere Großeltern – schuldlos?
Florian Illies feierte den Roman als "irrwitzigen Barock-Poetry-Slam". Der Text sei, so der Kritiker, ein "waghalsiges Spiel aus Wahrheiten und Täuschungen". Dabei hat Steven Uhly eigentlich eine schlichte Familiengeschichte geschrieben, die nur deshalb so ganz und gar nicht schlicht ist, weil die redenden Personen so ganz und gar nicht schlicht sind, sondern wunderbar meschugge. Selten habe es in den letzten Jahren so viel Spaß gemacht, auf einen Autor hereinzufallen, so Illies.
Eine Oma bekommt von ihrem Enkel ein Kind; hinter der jüdischen Identität des Opas verbirgt sich die Biographie eines Mörders. Das – und noch vieles mehr – kommt ans Licht durch die Erzählung eines jungen Mannes, dessen Kindheit geprägt ist von einem engen Verhältnis zur Großmutter, die alles ist, nur keine nette Omi. Was dieser (junge?) Mann zu erzählen hat, ist aberwitzig, ist grotesk, ist crazy – das zum einen. Zum anderen fragt er interessiert, was im Nachkriegsdeutschland eigentlich aufgearbeitet wurde oder eben nicht.
Den (jungen?) Mann gibt es in Friederike Drews' Theaterfassung auch – und die Oma, den Opa, die ganze Sippschaft geht ihr auch nicht verloren. Sie alle sind auf mirakulöse Weise anwesend. Gespielt nur von einer Schauspielerin und einem Schauspieler, die in Rollen schlüpfen und sich aus ihnen wieder winden; die sich hinter Masken verstecken oder mit den Masken die wahre Identität ihrer fiktiven Gestalten offenbaren. Friederike Drews hat einen umfangreichen Roman zu einem fünfundsiebzigminütigen Theaterabend komprimiert – und eben nicht zusammengestrichen. Naturgemäß kann ein solcher Prozess der Verdichtung dennoch nicht gelingen ohne Verluste. Aber jede Zuschauerin, jeder Zuschauer wird verstehen, worum es geht – auch ohne Kenntnis des Romans, da irrten die Berliner Kritiker, die glaubten, die Regisseurin überfordere das Publikum.
Wer den Roman zuvor kannte, fragte sich, wie solch eine Bearbeitung für das Theater überhaupt würde gelingen können. Warum nimmt sich eine Regisseurin dieses Stoffes an? Und wie ist sie überhaupt auf diesen Roman gestoßen? Ist das nicht ein Unterfangen, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist?
"Ich habe den Roman 2015 bei einem Dramaturgen rumliegen sehen, mitgenommen und gelesen", erklärt Friederike Drews. "Dann zugeklappt und gedacht: Ja, diese unverschämte Geschichte mit ihrem Humor und dem Aspekt von Verarbeitung deutscher Geschichte möchte ich auf der Bühne sehen. Und ich würde diese ausufernde Familiensaga nur mit einer Frau und einem Mann besetzen. Dann hat mich der Roman all die Jahre lang still begleitet, bis es am Deutschen Theater Berlin zu den Gesprächen über eine mögliche Inszenierung kam."
Friederike Drews war entschlossen, überhaupt macht sie den Eindruck, dass sie künstlerisch vor wenigen Dingen Angst hat. Sie traf den Autor. "Nach einem genussvollen Frühstück und ausführlichem Gespräch mit Steven Uhly hat er mir sein Vertrauen für die Bearbeitung ausgesprochen. Dann hat er von mir erst wieder kurz vor der Premiere gehört. Ich musste Abstand gewinnen vom Autor. Bei der Bearbeitung eines zeitgenössischen Textes fühle ich mich wie ein Eindringling. Das macht mir Spaß, aber fühlt sich gleichzeitig verboten an. Als Regisseurin habe ich die Freiheit und die Pflicht, auch mal mit der Axt liebevoll ans Werk zu gehen. Zunächst habe ich Orte, Personen und Handlungen katalogisiert und schnell festgestellt, welche Figuren und Szenarien ich benötige. Daraufhin habe ich das Buch konzentriert und die Dialoge extrahiert. Neunzig Prozent der Fassung sind original Uhly. Die Visionen fielen mir am schwersten, weil der epische Romantext in eine Theatersprache verwandelt werden musste. Von Anfang an war mir klar, dass ich Wortwitz und Erzähltempo von Steven Uhly in der reinen Textfassung verlieren würde und deswegen auf die Ebene des Spiels übertragen musste. Mir schwebte ein schneller Abend vor: Huch, schon vorbei. Schade." Steven Uhly war begeistert und ist es auch heute noch, weshalb er sich das Gastspiel bei Radikal Jung nicht entgehen lassen wird.
Genauso ist es: Huch, schon vorbei. Schade! Friederike Drews ist ein Coup gelungen! Zu gern hörte man die Gutenachtgeschichten der Oma noch einmal. Sie erfindet die verrücktesten Mordpläne, ihren Mann loszuwerden: Gebiss in Rattengiftflüssigkeit! Auch die Passagen über die sexuelle Aufklärung der Kinder und Enkel, die so gründlich daneben geht, beschäftigt die Hirne und die Fantasie der Zuschauer noch lange nach dem Ende der Aufführung. Und – ja, auch dies – die Unmoral der G'schicht bleibt selbst in der Erinnerung noch aufregend frisch. Nichts, so dachte ich nach der Lektüre des Romans und nach der Aufführung, nichts ist amüsanter als diese schier endlos scheinende Reihe von Tabubrüchen, sexuellen, ideologischen, historischen. "In Aspik" wird wirklich das Spiel gespielt, "the whole family can play".

Der Abend in der Box des Deutschen Theaters in Berlin beginnt mirakulös. Vor einem beigefarbenen Vorhang und von diesem zugedeckt liegt irgendwas, irgendwer am Boden. Die Schauspielerin Susanne Janson beweg sich stumm von rechts nach links gehend auf das mysteriöse Knäuel zu, stupst es mit dem Fuß, gibt ihm einen Klaps mit der Hand. Und da ist er: der Mann, der Ich-Erzähler, Simon Brusis.
Die beiden werden nun ständig die Rollen tauschen, werden Mann und Frau, Frau und Mann, Oma und Opa und Enkel. Ein Masken-, ein Schleier-, ein Vorhang-Spiel – und auch eines mit Videos. Rasant ist ihr Spiel und auch ihr Sprechtempo. Der Trick und der Reiz dieses Spiels ist der Gebrauch der Masken. Es war kein Einfall der Regisseurin. Ehrlich erklärt sie: "Auf die Idee der Masken kam Henrike Huppertsberg" – sie ist die Kostümbildassistentin am Deutschen Theater. "Meine erste Reaktion darauf war Misstrauen, weil ich mir sofort unsichtbare Gesichter und Mikroports vorgestellt habe. Aber unsere angepassten Halbmasken, die für jede Figur individuell gestaltet sind, haben mich sehr schnell überzeugt. Dadurch wird ein rasanter Rollenwechsel möglich, und das Spiel wurde zum doppelten Spiel. Außerdem konnten wir so auf Umzüge und Requisiten verzichten."
Dieses rasante Spiel auf engstem Raum – die erste Zuschauerreihe ist vielleicht zwei Meter von der Spielfläche entfernt – konnte nur gelingen dank eines genialisch einfachen Bühnenorts, gestaltet von Ev Benzing. "Wir beide", so Friederike Drews, "hatten unabhängig voneinander die Vision von einem Gerüst und davor eine Fassade. Wichtig war mir, dass der Bühnenraum sich nach und nach entblättert und immer wieder eine neue Überraschung für den Zuschauenden und Spielenden bereithält. Ich lege Wert auf Bühnen, die dem Spiel dienen und bedient werden können. Ev Benzing entwickelte daraus die Idee der Schichten, die nach und nach abgetragen und aufgedeckt werden. Das Gerüst ist schlussendlich viel mehr geworden als ein Gerüst: Es wird selbst zum Spieler, stählernen Stammbaum, Labyrinth, Klettergerüst: ein Strudel." Und dieses Mitspielobjekt erfüllt viele Funktionen, wird bespielt eben auch mit und von einem Bildschirm.
Friederike Drews‘ Uhly-Inszenierung, die am 29. September 2022 in der Box des Deutschen Theaters Berlin herauskam, war nicht ihr Debüt als Regisseurin. Ihre erste Arbeit für ein Theater hatte 2022 am Gerhart Hauptmann-Theater in Görlitz Premiere, "Der Kontrabass" von Patrick Süsskind. Ihre eigentliche Karriere startete sie bereits 2008, als sie ihr Schauspielstudium in Berlin begann. "Als Kind wollte ich Zimmermann werden (sagte man damals noch so), und jetzt bin ich Regisseurin. Rückblickend ergibt das natürlich eine gerade Linie. Zwischendurch spielte ich im Jugendsinfonie Orchester, legte als archäologische Hilfskraft menschliche Skelette frei, studierte Schauspiel, arbeitete als Schauspielerin, volontierte im Kulturmanagement, und dann sprang plötzlich der Funke über: zur Regie. Da hat sich auf einmal alles richtig angefühlt."
Und sie war Regieassistentin, arbeitete mit Sewan Latchinian, Martin Stefke, Jürgen Eick, Angelika Zacek und Beatrix Schwarzbach. Von 2019 an bis zum Ende der Intendanz von Ulrich Khuon gehörte Friederike Drews als Regieassistentin zum Ensemble des Deutschen Theaters Berlin, unter anderem arbeitete sie mit Andres Veiel, Philipp Arnold, Anne Lenk, Andreas Kriegenburg, Jette Steckel, Armin Petras, Lilja Rupprecht, René Pollesch und Jossi Wieler. 2021 entwickelte sie einen Theater-One-Take-Film mit den DT-Ensemblemitgliedern Niklas Wetzel und Julia Windischbauer: "Bremsspuren" von Nicola Bremer war die erste digitale Limited Edition des Deutschen Theaters.
Die Wahl von Steven Uhlys Roman ist kein Zufall. Friederike Drews interessiert, wie sie es selber nennt, „das Politische im Privaten“. Sie suche in allen Stoffen nach der Lust am Spiel für ihr Ensemble, weil dann das Publikum auch Lust habe und sie alle etwas gemeinsam erlebten. Bedeutet das ein Desinteresse für sogenannte Klassiker? "Ich kann mir nicht nur vorstellen, Klassiker zu inszenieren, ich werde es auch tun. In Cottbus inszeniere ich kommende Spielzeit Shakespeare. Ich habe Lust auf einen so widerstandsfähigen Text wie den ‚Sommernachtstraum‘. Außerdem habe ich mein Vorbild Anne Lenk im Ohr, die sagte, dass jungen Regisseurinnen und Regisseuren viel früher in ihrer Karriere Klassiker angeboten werden sollten. 'Antigone' steht ganz oben auf meinem Zettel."
Und nach dem Shakespeare? – "Weiter. Immer weiter."
Mehr zum Autor

C. Bernd Sucher – Autor, Theaterkritiker, Hochschullehrer. Dissertation über "Martin Luther und die Juden"; seit 1998 Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Jury-Mitglied von Radikal Jung seit der Gründung des Festivals.